„Irgendwann im Jahre 1930 saß ich mit einigen Menschen zusammen und diskutierte über literarische Formen und dabei dachte ich schon fast an diesen Roman. Mir rutschte die Bemerkung heraus – und es war meine absolute Überzeugung –, dass ich in meinem ganzen Leben kein Buch in Ich-Form und kein Buch über Kindheit schreiben würde. Ein Flüchtling kreuzt seine Spur ist in Ich-Form geschrieben, und größtenteils geht es um Kindheit und Jugend. Drei Monate nachdem ich kategorisch erklärt hatte, dass es niemals so weit kommen würde, lag die erste Fassung vor.“
So beginnt das Vorwort von Aksel Sandemose, das der sehr schönen Ausgabe von Ein Flüchtling kreuzt seine Spur im Guggolz Verlag (2019) vorangestellt ist. Das Original dieses ungewöhnlichen Textes erschien erstmals 1933 und dann in einer überarbeiteten Version 1955 in Dänemark, die deutsche Übersetzung stammt von Gabriele Haefs. Weitere Informationen finden sich auf der Verlagsseite.
Als ich vor gut fünf Jahren den Impuls verspürte, einen (größeren) autobiographischen Text zu schreiben, widersprach das meinen Vorstellungen von mir, von den Texten, die ich schreiben wollte auf eines ganz ähnliche Weise. Noch wenige Monate zuvor war ich mir vollkommen sicher gewesen, dass ich niemals über mich, über mein Leben schreiben würde. Das hatte mehrere Gründe, aber der wichtigste war sicherlich, dass ich weit und breit in meinem Leben, in meiner Vergangenheit nichts sah, das irgendwie besonders gewesen wäre (über die Frage, inwiefern autobiografische Texte besonders sein müssen oder nicht, habe ich kürzlich in dem Beitrag Was könnte das Besondere an meiner Geschichte sein? geschrieben). Und als ich dann doch über eine unverstandene Besonderheit (meine „Lebensgeschichtslosigkeit“) stolperte, da blieb dennoch zunächst ein vages Unbehagen. Kreisten Autor:innen autobiografischer Texte nicht mit einer gewissen Unausweichlichkeit um sich selbst? War ich nun auch eine, die sich zu wichtig nahm? Steckte nicht in jedem autobiographischen Projekt eine große Portion Selbstüberschätzung oder narzisstische Selbstbespiegelung?
Ich halte das mittlerweile für einen gravierenden und weit verbreiteten Irrtum und zwar in gleich zweierlei Hinsicht. Einerseits macht es gerade die guten autobiographischen Texte aus, dass sich in dem Besonderen des selbst Erlebten etwas Allgemeines spiegelt. Das Jahr magischen Denkens von Joan Didion, Wie wir begehren von Carolin Emcke, Rückkehr nach Reims und Gesellschaft als Urteil von Didier Eribon, Die zitternde Frau von Siri Hustvedt, Nüchtern von Daniel Schreiber, Die Argonauten oder Die roten Stellen von Maggie Nelson – in all diesen Texten geht es immer um ein Thema, das die Autorin, den Autor nicht loslässt, um das Gefühl, dass etwas, das man selbst erlebt hat, eine Seite aufweist, die bislang übersehen oder nicht hinreichend verstanden wurde.
Es gibt zweifellos Autor:innen, die auf eine Weise um sich selbst kreisen, die ich als unangenehm empfinde und die ihrer Wut, ihrem Zorn, vor allem ihrem Ressentiment ungefiltert Ausdruck verleihen – auf die Welt, auf die Frauen, worauf auch immer. Aber diese Autor:innen schreiben keineswegs vorwiegend autobiographische Text, sondern sie toben sich genauso in fiktiven oder journalistischen Gefilden aus. Ebenso wie es fiktive Text gibt, in denen Autor:innen „sich entblößen“, gibt es autobiographische Text von großer Diskretion.
„Die Autoren, die mir am meisten bedeutet haben“, schreibt Didier Eribon in Gesellschaft als Urteil, „waren meist auch diejenigen, die mir deshalb etwas geben konnten, weil sich ihr Schreiben auf einer Sorge um andere gründete.“ Und wenige Zeilen später: „Bei der Beurteilung des Werks eines Autors oder einer Autorin darf man, unabhängig von den Kritikpunkten, die man für notwendig erachtet, niemals die Frage aus den Augen verlieren, was sie im Moment des Schreibens erreichen wollten. Was wollten sie den Menschen, die an die sie sich richteten, sagen? (…) Welche Strategien verfolgten sie? Wem oder was wollten sie sich mit ihren Diskursen entgegenstellen? Die Umkehrung dieser Gedanken ist nicht weniger wahr: Die Autoren, die wir nicht mögen, sind solche, die nichts für uns tun und uns nicht behilflich sein wollen, wie uns demobilisieren, paralysieren und ersticken (oder dies zumindest versuchen).“
Anne Bogarts klugen Essays über Kunst und Theater (Die Arbeit an sich selbst) verdanke ich den Hinweis auf Lewis Hyde, der in seinem Buch Die Gabe: Wie Kreativität die Welt bereichert die These verritt, dass Menschen entweder aus einem Überlebensinstinkt oder einem Schenkimpuls heraus handeln. Anne Bogart schreibt „Wie der Überlebensinstinkt, so erfordert auch der Schenkimpuls Tatkraft und Entschlossenheit, das Ergebnis ist aber ein anderes, weil die Intention hinter der Handlung nichts mit Sicherheit zu tun hat. Die Handlung entspringt dem Impuls, jemandem etwas zu schenken, und dem Drang, anderen eine Reise außerhalb ihres täglichen Erfahrungshorizonts zu ermöglichen. Dieser Instinkt erfodert Großzügigkeit, Interesse am anderen und Einfühlungsvermögen.“
Ähnlich wie die innere Notwendigkeit eines autobiographischen Textes seine literarische Qualität weder automatisch unterhöhlt noch verbürgt, sagt die Tatsache, ob ein Text fiktiv oder autobiographisch ist, nichts über die innere Haltung seiner Autorin, seines Autors aus und über die Frage, aus welchem Erzählimpuls er entspringt.
Ich freue mich auf Eure Eindrücke, Gedanken, Fragen!

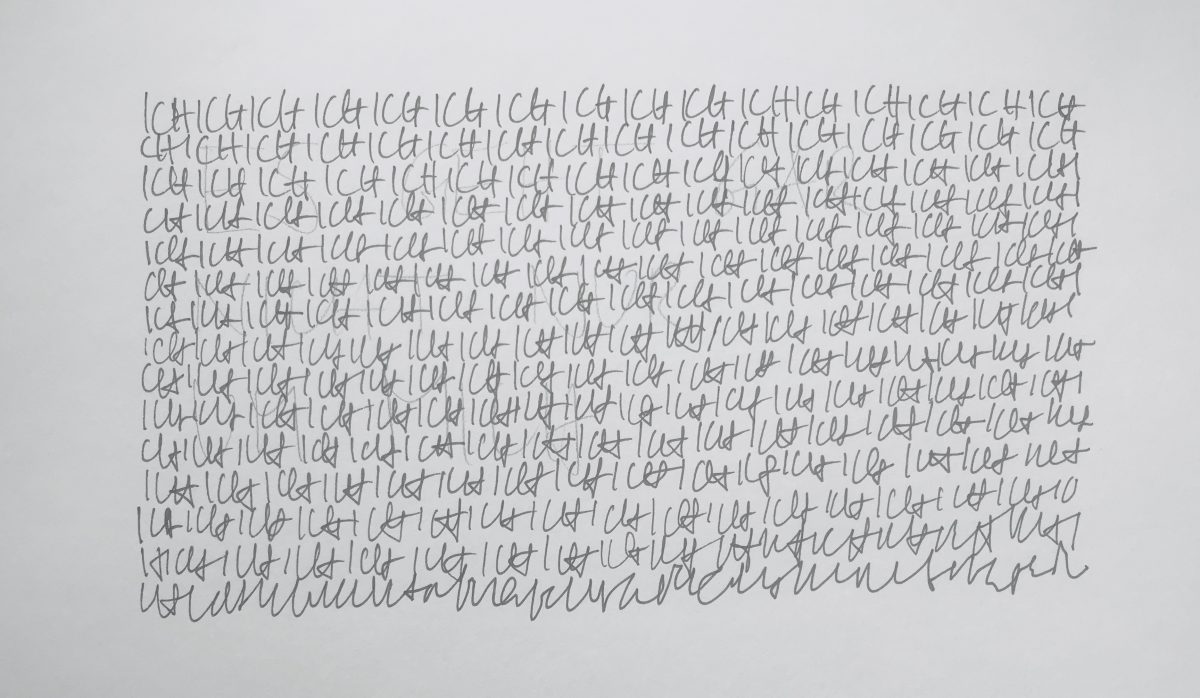
„Wer schreibt, legt Zeugnis ab“, sagte Jack Kerouac.
Anzumerken hätte ich höchstens, dass auch autobiografische Bücher kein absolut der Erinnerung entsprechendes Bild zeichnen können . Es wird immer lückenhaft und manchmal auch chronologisch dazugedacht sein. Nicht nur begeistern mich Texte, die „von Sorge um andere“ bestimmt sind. Manche impressionistische und „um sich selbst kreisende“ Autobiographie“ ist faszinierend oder schillernd in ihrer Sprachkraft. Wenn es Literatur ist, steht der Inhalt hinter dem Ausdruck zurück…auch autobiographisch, oder? Sucht, findet sich künstlerisch nicht zunächst ein Ausdruck, ohne dabei gleich an mögliche Konsumenten dabei zu denken, oder…?
Fragen, die mich beschäftigen…
Erfahrungswert: mein erst einmal ungehemmtes Schreiben dauert weniger lang als das darauf folgende bewusste Lektorieren, das Achtgeben auf Form und Ausdruck. Sie lassen dann (idealerweise, uik…🙈) den Inhalt erstrahlen.
Lieber Dank für diese spannenden Beiträge, die ich liebe zu lesen.
Herzlich
Amélie
Vielen Dank für deine Gedanken und für die schöne Rückmeldung, über die ich mich sehr freue! Und ja, ich denke auch und hatte ja kürzlich genau darüber geschrieben, dass das Besondere oft mehr im „Wie“ (des sprachlichen Ausdrucks) als im „Was“ (des Erlebten) liegt. Aber natürlich gibt es auch Texte, deren Erzählimpuls sehr stark von der inhaltlichen Seite ausgelöst wird, von einem „Ich habe etwas erlebt/entdeckt, davon möchte ich jetzt (unbedingt) erzählen“ …
Herzliche Grüße!
Was für spannende und inspirierende Gedanken! Danke. Ich kau da mal drauf rum und weiter. 🙌🏻
… das freut mich!
Liebe Jutta,
mit fällt dazu auch Max Frisch ein, der in seinem Tagebuch 1940 – 1949 schreibt: „Man hält die Feder hin, wie eine Nadel in der Erdbebenwarte, und eigentlich sind nicht wir es, die schreiben; sondern wir werden geschrieben. Schreiben heißt: sich selber lesen.”
Und so ist das Schreiben einmal eine Selbsterkundung, zum anderen – wenn es gut ist – aber auch eine Erkundung des Allgemeinen, das sich in der erzählten Geschichte im Besonderen zeigt.
Ich denke da gerade an Meggie Nelson, die ich kürzlich gelesen habe und die so klug und differenziert von ihren eigenen Erlebnissen „roten Stellen“ eben die des lebenslangen Prozesses, sich mit dem (ungesühnten) gewaltsamen Tod der Tante auseinanderzusetzen. Und auch wenn ich solch einen Fall – zum Glück – nicht in der Familie habe, kann ich ich ihre Überlegungen mit Gewinn lesen, weil ich so nachvollziehen kann, wie es sich anfühlt, mit den „roten Flecken “ in der Familiengeschichte. Und lerne auch von der großzügigkeit der Familie der Familie des vermutlichen Täters gegeüber, von der Aufgabe, die Polizisten darin sehen, ungeklärt Mordfälle endlich aufzuklären usw.
Viele Grüße, Claudia
Liebe Claudia, vielen Dank für deine Gedanken und auch den Hinweis auf Maggie Nelson, die ich sehr schätze (auch „Die Argonauten“ ist ein großartiges Buch, das mich sehr inspiriert hat, insbesondere, was die Verflechtung von theoretischen und erzählenden Passagen betrifft).
Ich glaube auch, dass literarische Texte uns auf eine spezielle Weise ermöglichen, Erfahrungen miteinander zu teilen. Wir müssen es nicht selbst erlebt haben, aber wir können ein wenig in die Köpfe anderer schauen, die etwas anderes erlebt haben – oder auch in die Köpfe derer, die etwas Ähnliches erlebt haben und dafür Ausdrucksformen, Worte gefunden haben.
Viele Grüße auch an dich!
Hmmm, mit der Verknüpfung von Schreiben bzw Schreibintension mit moralischen Kriterien bin ich auf den ersten Blick nicht so glücklich. Ich mag schon den Gedanken nicht, dass für eine bestimmte Zielgruppe geschrieben wird. Aber ich werde noch darüber nachdenken.
Ich frage mich nach der Lektüre deines und auch anderer Kommentare gerade, ob ich vielleicht (noch) deutlicher hätte mache sollen, dass es mir nicht darum geht, (moralische) Forderungen aufzustellen oder bestimmte Texte/Autor:innen abzuwerten, sondern eher umgekehrt, Texte/Autor:innen gegen weit verbreitete Vorstellungen (die ich selbst auch lange Zeit auf eine unklare Weise hatte) zu verteidigen. Und in diesem Beitrag eben vor allem gegen die Vorstellung, dass wer „Ich“ sagt, (zwangsläufig) primär an (s)ich interessiert ist. Meine Position ist nicht: Texte/Autor:innen müssen xy (z. B.großzügig) sein. Meine Position ist: Auch (gerade) autobiographische Texte können aus einer großzügigen inneren Haltung heraus geschrieben sein.
Aber es geht mir hier, wie fast immer im Nachdenken über Texte: So allgemeine Aussagen bergen immer die Gefahr von Missverständnissen – klarer wird es, wenn wir uns über konkrete Texte und wie wir sie lesen/wahrnehmen austauschen.
Vielen Dank jedenfalls für deinen Kommentar – ich werde auch noch weiter darüber nachdenken!
Dann haben sich diese Vorurteile nicht bis zu mir herumgesprochen. 😮🙃 Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das Schreiben in der Ich – Form zwangsläufig Selbstbespiegelung sein muss. Und wenn doch, so finde ich es völlig legitim sich ausschließlich der eigenen Person zu widmen oder auch Meinumgen zu vertreten, die den gerade herrschenden MoralvorStellungen widersprechen. Literatur muss nicht lieb, brav und selbstlos sein.
Aber vielleicht bin ich da jetzt ganz woandets als bei deiner ursprünglichen Idee.
Nein, gar nicht woanders 😉 Ich habe auf Anhieb kein besseres Beispiel gefunden, aber dieses ist vielleicht auch schon aussagekräftig: https://www.nzz.ch/feuilleton/autobiografische-sachbuecher-die-folklorisierung-der-eigenen-lebensgeschichte-ld.126634
Leider kann ich nur die ersten Zeilen vor der paywall lesen, aber ich vermute, dass die beiden in der Luft zerrissen werden ?
Myriade, ich kann ihn lesen, ich schicke ihn dir 😁
Oh danke ! So schnell muss ich ja nun auch wieder nicht schlafen gehen 🙂
Ist raus, schau mal nach 😁
Oh toll, vielen Dank auch von mir!
Das ist genau die Art von Literaturkritik, die ich freiwillig nicht lese !
Das bringt mich auf die Idee, meine Schubladentexte noch einmal aus dieser Sicht anzuschauen.
Danke dafür.
Das freut mich. Ich wundere mich manchmal, wie sich manche meiner Texte verändern, je nachdem wen ich mir als Leser:in vorstelle. (Beim Schreiben stelle ich mir nie konkrete Personen vor, aber später schon, u. a. wenn ich mich frage, wer eine gute Testleserin wäre.)